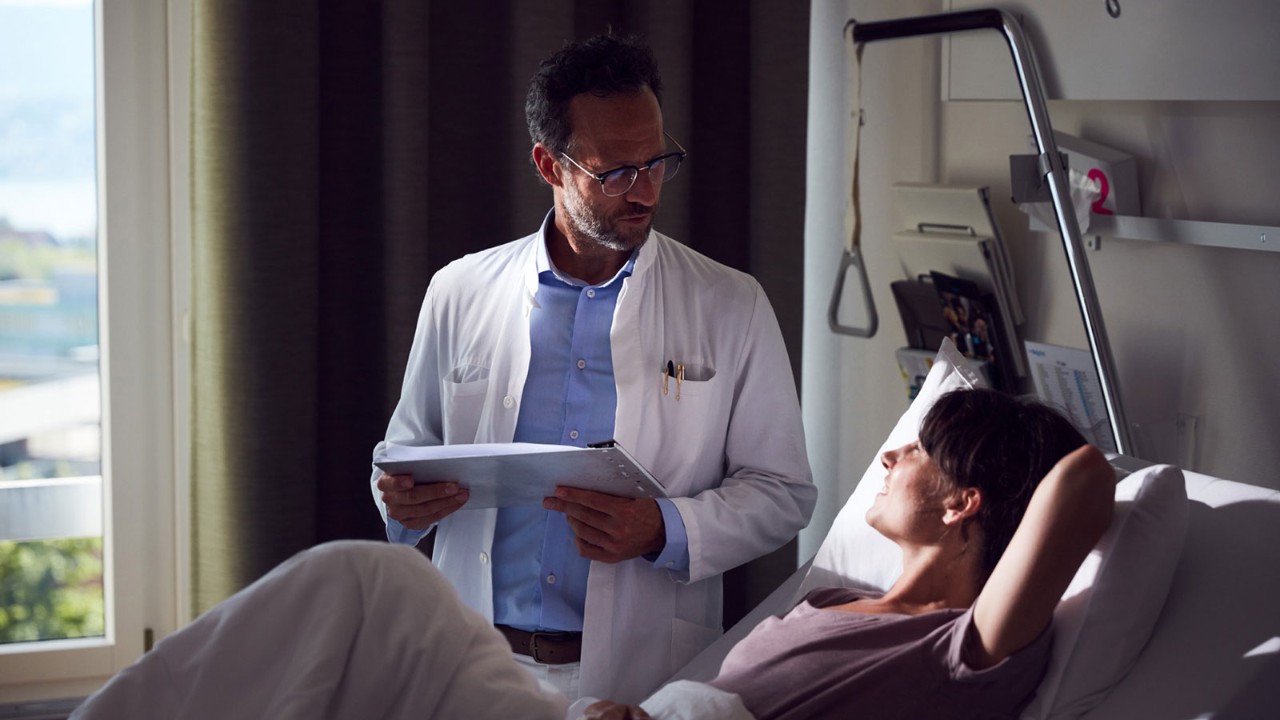Demenz erkennen und damit umgehen
Jede dritte Familie in der Schweiz ist direkt oder indirekt von Demenz betroffen. Heilen lässt sich die Erkrankung nicht, trotzdem ist die Früherkennung wichtig.

Häufig ist es ein schleichender Prozess. Die Betroffenen fühlen sich kraftlos, sind schnell müde, gereizt und schlafen schlecht. Es fällt ihnen zunehmend schwer, sich Dinge zu merken oder sich in neuen Umgebungen zu orientieren. Sie werden launisch und ziehen sich allmählich zurück. All das können erste Anzeichen für eine Demenz sein.
153 000 Menschen in der Schweiz leiden an Alzheimer oder einer anderen Form von Demenz – jedes Jahr kommen weitere 33 000 Fälle hinzu. Jede dritte Familie ist somit direkt oder indirekt von diesem Thema betroffen. Weil das Alter der bedeutendste Risikofaktor für Demenz ist und unsere Bevölkerung immer älter wird, gehen Experten davon aus, dass diese Zahl künftig sogar noch ansteigen wird.
Ein Name – mehr als 100 Krankheitsformen
Demenz ist der Oberbegriff für mehr als 100 verschiedene Krankheitsbilder, welche die Funktion des Gehirns beeinträchtigen. Vor allem geistige Bereiche wie das Denken, das Gedächtnis, die Orientierung und die Sprache sind bei Demenz betroffen.
Die wichtigste Unterscheidung ist jene, ob es sich um eine primäre oder sekundäre Demenz handelt. Eine primäre Demenzerkrankung wird durch den Abbau von Nervenzellen im Gehirn ausgelöst. Dabei sterben die Nervenzellen des Gehirns ohne erkennbare Ursache ab. Zu den häufigsten Formen einer primären Demenz gehören: Alzheimer-Demenz, die für ungefähr 60 Prozent der Demenzerkrankungen verantwortlich ist, vaskuläre Demenz, Lewy-Körperchen-Demenz oder auch die Frontotemporale Demenz.
Wesentlich seltener ist die sekundäre Demenzerkrankung. Nur knapp 10 Prozent aller Demenzerkrankungen werden durch eine Grunderkrankung ausgelöst. Dabei sterben Gehirnzellen infolge einer organischen Krankheit wie beispielsweise einer Infektion, einer Hirnverletzung, eines Hirntumors oder einer Herz-Kreislauf-Erkrankung ab.
Gewisse Faktoren, die eine Demenz wahrscheinlicher machen, lassen sich nicht verändern, beispielsweise Alter, Geschlecht oder bestimmte vererbte genetische Veränderungen. Trotzdem gibt es Möglichkeiten, vorzubeugen und das Risiko, an Demenz zu erkranken, zu reduzieren. Dazu gehören eine gesunde Ernährung, viel Bewegung und Gedächtnistraining. Demnach können Aktivitäten wie tägliches Lesen, Denksportaufgaben, Musizieren, Tanzen oder etwas Neues lernen das Gehirn fit halten und so einer Demenz vorbeugen.
Die Finger lassen sollte man hingegen von Zigaretten, Arzneistoffen und Giften wie Alkohol – sie alle können eine Demenz begünstigen.
Demenz: Achten Sie auf diese Symptome
Demenz ist weit mehr als nur gelegentliche Vergesslichkeit. Wenn jemand häufig wichtige Verabredungen vergisst oder sich nicht mehr an bedeutsame Ereignisse wie Geburtstage oder Familienfeste erinnert, kann das ein Anzeichen für eine Gedächtnisstörung sein, die mit Demenz in Zusammenhang steht. Besonders zu Beginn ist oft das Kurzzeitgedächtnis betroffen, später dann auch das Langzeitgedächtnis.
Ein weiteres häufiges Symptom ist das Ringen um Worte mitten in einem Gespräch. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Betroffene Wörter aus einem ähnlichen Kontext benutzen oder sogar neue Wörter erfinden. Hinzu kommt eine Desorientierung in Raum und Zeit. Diese zeigt sich darin, dass sich Menschen in vertrauten Umgebungen plötzlich verloren fühlen oder ihre eigenen Geburtsdaten nicht mehr korrekt wiedergeben können.
Besonders besorgniserregend ist es, wenn jemand vertraute Personen nicht mehr erkennt oder sie mit anderen verwechselt. Auch der Umgang mit alltäglichen Gegenständen kann beeinträchtigt sein, beispielsweise wenn jemand versucht, sich mit der Kochkelle die Haare zu bürsten. Die Fähigkeit, sich an gewohnte Abläufe oder Tätigkeiten zu erinnern, kann ebenfalls verloren gehen. Betroffene können sich dadurch verunsichert und überfordert fühlen.
Frühzeitige Demenzdiagnose ist wichtig
Vielfach sind es nicht die Betroffenen selbst, die eine Veränderung bei sich feststellen, sondern die Angehörigen. In diesem Fall empfiehlt es sich, sich mit engen Freunden und anderen Familienangehörigen auszutauschen, um zu sehen, ob auch sie ein untypisches Verhalten festgestellt haben. Die Organisation Alzheimer Schweiz rät dazu, die Sorgen der betroffenen Person mitzuteilen und gemeinsam mit ihr zum Hausarzt zu gehen, um persönliche Empfindungen sowie Beobachtungen einer nahestehenden Person schildern zu können.
Die Diagnose von Demenz beginnt vielfach bei der Hausärztin oder dem Hausarzt. Sie nehmen die Vorgeschichte der betroffenen Person auf und führen sowohl körperliche als auch neurologische Untersuchungen durch. Um einen ersten Überblick über den kognitiven Zustand zu erhalten, helfen meist schon demenzspezifische Kurztests wie die Mini-Mental-Status-Untersuchung oder der Uhrentest. Bei unklaren Diagnosen oder komplexeren Fällen kann zudem eine Überweisung an eine Memory Clinic sinnvoll sein.
Nach der Diagnose ist die ärztliche Begleitung von zentraler Bedeutung. Die Fachpersonen überwachen den Verlauf der Erkrankung. Sie können auch Massnahmen empfehlen und einleiten, um die Betroffenen zu unterstützen. Es ist wichtig, dass auch die Angehörigen in den Diagnose- und Behandlungsprozess einbezogen werden, um ihnen die bestmögliche Unterstützung und Beratung zu bieten.
Informieren Sie sich über Demenzerkrankungen, den Krankheitsverlauf und Unterstützungs- und Entlastungsangebote. Informationen finden sich unter anderem in verschiedenen Broschüren und Infoblättern von Alzheimer Schweiz.
Lassen Sie sich beraten. Zum Beispiel durch eine Fachperson des nationalen Alzheimer-Telefons (Tel. 058 058 80 00, info@alz.ch).
Demenz: oft unheilbar, aber selten unbehandelbar
Die Behandlung von Demenz, insbesondere Alzheimer, beinhaltet sowohl nicht medikamentöse als auch medikamentöse Ansätze. Im Vordergrund steht die ganzheitliche Betreuung, um das Wohlbefinden und die Selbstständigkeit des Patienten oder der Patientin so lange wie möglich zu erhalten.
Nicht medikamentöse Therapien wie Ergotherapie, Logopädie, Kunst- und Musiktherapie sind zentral für die ganzheitliche Betreuung. Ergotherapie zielt darauf ab, tägliche Aktivitäten zu erleichtern, wodurch die Lebensqualität verbessert wird. Die Logopädie unterstützt insbesondere bei Sprach- und Schluckstörungen. Spezielle Ansätze wie Kunsttherapie nutzen kreative Prozesse, um Kommunikation und Selbstwahrnehmung zu fördern, während Musiktherapie über Ton und Rhythmus Gefühle und Ängste anspricht.
Zwar gibt es kein Heilmittel gegen Demenz, Medikamente wie Antidementiva können jedoch die Entwicklung verlangsamen und die Lebensqualität verbessern. Bei Alzheimer werden häufig Cholinesterase-Hemmer oder Memantin verwendet, welche die Informationsübertragung im Gehirn fördern. Ginkgoextrakt, ein pflanzlicher Wirkstoff, verbessert zudem die Gehirndurchblutung und kann Symptome wie Vergesslichkeit und Schwindel lindern.
Es ist wichtig, auch allfällige Begleitsymptome wie Depression, Schlafstörungen oder Aggressivität zu behandeln. Hier ist besondere Vorsicht geboten, da die medikamentöse Behandlung oft mit Nebenwirkungen verbunden ist. Ein individueller Therapieplan ist für den Therapieerfolg von zentraler Bedeutung.
Demenz: die wichtige Rolle der Angehörigen
«Wer im Alltag Veränderungen im Verhalten eines geliebten Menschen feststellt, ist vielfach verunsichert. Es empfiehlt sich, das Tabu zu durchbrechen, indem man seine Beobachtungen offen und wertfrei schildert und sagt, wie man sich dabei fühlt», rät Agnès Henry, Fachberaterin Demenz beim nationalen Alzheimer-Telefon der gemeinnützigen Organisation Alzheimer Schweiz.
Auch der Austausch mit anderen nahestehenden Personen oder dem Hausarzt kann sinnvoll sein, um die eigenen Beobachtungen einzuordnen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, ob es sich tatsächlich nur um Zufälle oder um eine beginnende Demenz handelt. Vermeiden sollte man hingegen genervte und anklagende Worte, so Henry. «Betroffene Menschen spüren, dass sich etwas verändert. Entsprechend wichtig ist es, dass das Vertrauensverhältnis zu ihren Angehörigen erhalten bleibt», erklärt sie weiter.
Steht die Diagnose Demenz einmal fest, beginnt sowohl für den betroffenen Menschen wie auch für die direkten Angehörigen ein neuer Lebensabschnitt. Einer, der von viel Unsicherheit und stetiger Veränderung geprägt ist. Dabei ist es wichtig, dass die Erkrankten nicht überbehütet und beschützt werden. «Demenzkranke sollten weiterhin möglichst viel selbst machen. Wobei eine Risikoabwägung durch eine Drittperson natürlich sehr wichtig ist», so Henry.
Ebenfalls entscheidend: Stress vermeiden. Dieser kann bei Demenzerkrankten sehr viel schneller ausgelöst werden als bei gesunden Menschen. «Klare Anleitungen, kurze und einfache Sätze sowie gleichbleibende Rituale helfen Betroffenen dabei, sich zu orientieren und sicher zu fühlen», weiss Fachexpertin Henry.
Die Herausforderung bei der Betreuung und Pflege eines Angehörigen mit Demenz ist, sich dabei nicht selbst zu vergessen. «Diese Erkrankung verlangt Nahestehenden emotional und körperlich viel ab. Entsprechend wichtig ist es, sich Hilfe zu holen. Sie müssen das nicht allein bewältigen», appelliert Henry. So kann es bereits helfen, andere Familienmitglieder oder Freunde darum zu bitten, einige Stunden mit dem Demenzkranken zu verbringen, um so für sich selbst ein freies Zeitfenster zu schaffen.
Da Demenz die Persönlichkeit verändern kann, sehen sich Angehörige häufig mit einem Abschied auf Raten konfrontiert. Angehörigengruppen können wertvolle Unterstützung im Trauer- und Verarbeitungsprozess bieten. «Je mehr man über die eigenen Erfahrungen spricht und sich mit anderen betroffenen Angehörigen austauscht, desto besser lässt sich die Situation verarbeiten», sagt Henry.